 Melancholische Gedichte
Melancholische Gedichte
Zart Gedicht, wie Regenbogen,
Wird nur auf dunklen Grund gezogen;
Darum behagt dem Dichtergenie
Das Element der Melancholie.
(Johann Wolfgang von Goethe, 1749-1832)
Wohl nicht nur aus solch ästhetischen Gründen und als dankbarer Hintergrund für die Leuchtkraft der Poesie ist die Melancholie ein bedeutsames Thema der Literatur aller Zeiten und Sprachen. Für Europa prägend war eine Frage aus dem antiken Griechenland (Aristoteles zugeschrieben, aber wahrscheinlich von Theophrast):
Warum sind alle hervorragenden Männer, ob Philosophen, Staatsmänner, Dichter oder Künstler, offenbar Melancholiker gewesen?
Zu seinem Leitstern erhebt sie Nikolaus Lenau, der ein Inbild des melancholischen Lyrikers abgab, während schon im Mittelalter Walther von der Vogelweide im ersten Teil seines Gedichtes Reichston mustergültig die grüblerische Melancholiepose zeichnet:
Du geleitest mich durchs Leben,
Sinnende Melancholie!
Mag mein Stern sich strahlend heben,
Mag er sinken - weichest nie!
Führst mich oft in Felsenklüfte,
Wo der Adler einsam haust,
Tannen starren in die Lüfte
Und der Waldstrom donnernd braust.
Meiner Toten dann gedenk ich,
Wild hervor die Träne bricht,
Und an deinen Busen senk ich
Mein umnachtet Angesicht.
(Nikolaus Lenau, 1802-1850)
Ich saz ûf eime steine
und dahte bein mit beine,
dar ûf satzt ich den ellenbogen;
ich hete in mîne hant gesmogen
daz kinne und ein mîn wange.
dô dâhte ich mir vil ange,
wie man zer welte solte leben.
deheinen rât kond ich gegeben,
wie man driu dinc erwurbe,
der keinez niht verdurbe.
diu zwei sint êre und varnde guot,
daz dicke ein ander schaden tuot.
daz dritte ist gotes hulde,
der zweier übergulde.
die wolte ich gerne in einen schrîn:
jâ leider desn mac niht gesîn,
daz guot und weltlich êre
und gotes hulde mêre
zesamene in ein herze komen.
stîg unde wege sint in benomen;
untriuwe ist in der sâze,
gewalt vert ûf der strâze,
fride unde reht sint sêre wunt.
diu driu enhabent geleites niht,
diu zwei enwerden ê gesunt.
(Walther von der Vogelweide, ca. 1170-1230)
Aus den griechischen Wörtern melas=schwarz und cholé=Galle prägte sich auch der Begriff, und dieser zeigt, dass Schwermut und Hirnzermartern ursprünglich medizinisch hergeleitet wurden. Ein Übermaß an Sekretion schwarzer Galle soll jenes Krankheitsbild bewirkt haben, das man heute eher als Depression bezeichnet. Dies geschah im Rahmen der bis zur Entdeckung des Blutkreislaufs verbindlichen Lehre der vier Temperamente, die auf unterschiedliche Körpersekrete zurückgeführt wurden und außer dem Typ des Melancholikers noch den Sanguiniker, Choleriker und Phlegmatiker umfassten. Wenn auch wissenschaftlich längst veraltet und widerlegt, wirken diese Temperamente in einem symbolischen Geflecht mit den Vierheiten der Elemente, Tages-, Lebens- und Jahreszeiten bis heute nach und erwiesen sich für Kunst und Literatur als sehr fruchtbar.
Die Melancholie gehört in dieser Hinsicht zum Element Erde und dem Lebensalter des Erwachsenen, dazu klingt sie mit dem Abend und dem Herbst ineins - ein Akkord, dem man bei ![]() Georg Trakl nachlauschen kann. Dem musikalisch-ästhetisches Moment der Melancholie, das schon aus Lenaus Gedicht spricht, begegnet man auch bei Elise Sommer.
Georg Trakl nachlauschen kann. Dem musikalisch-ästhetisches Moment der Melancholie, das schon aus Lenaus Gedicht spricht, begegnet man auch bei Elise Sommer. ![]() Rainer Maria Rilke gesteht gar seine Liebe zu ihr.
Rainer Maria Rilke gesteht gar seine Liebe zu ihr.
Immer wieder kehrst du Melancholie,
O Sanftmut der einsamen Seele.
Zu Ende glüht ein goldener Tag.
Demutsvoll beugt sich dem Schmerz der Geduldige
Tönend von Wohllaut und weichem Wahnsinn.
Siehe! es dämmert schon.
Wieder kehrt die Nacht und klagt ein Sterbliches
Und es leidet ein anderes mit.
Schaudernd unter herbstlichen Sternen
Neigt sich jährlich tiefer das Haupt.
(Georg Trakl, 1887-1914)
Der Abend sinkt hernieder,
Die Silberwolke taut;
Stumm sind des Haines Lieder,
Der Berge Blau ergraut;
Bewegt vom Abendwinde,
Wiegt sich der Blütenzweig
Der hohen duft'gen Linde
Im mondbeglänzten Teich.
Laut stürzt die Felsenquelle,
Von Silberstaub beschäumt,
Hin in des Stromes Welle,
Vom Abendrot besäumt!
Dumpf hallt aus öder Ferne,
Des Uhus wildes Schrein,
Bleich flimmern Mond und Sterne
Auf dunkelm Kirchhofshain.
Der Tag, im Nebelschleier
Der Dämm'rung eingehüllt,
Malt mir mit ernster Feier,
Melancholie! dein Bild,
Wie schwebt so matt und traurig
Der blasse Mond empor,
Wie tönt so ernst und schaurig
Der Unke Ruf im Moor!
Wie melancholisch flüstert
Der kleinen Grille Lied,
In banger Stille knistert
Das falbe, dürre Ried.
Ich seh', gestimmt zur Trauer,
Dort blaue Flämmchen wehn,
Und Geister an der Mauer
Im Leichgewande stehn.
Hier, wo mich ernster Schauer
Mit kalter Hand ergreift,
Und jedes Bild die Trauer
Der bangen Seele häuft,
Hier schwinden wie Atome,
Vor meines Geistes Blick,
Die täuschenden Phantome
In ihre Nacht zurück!
Das Schlummer-Grab der Müden
Ruft laut und wahr mir zu:
»Hier herrschet ew'ger Frieden
Und nie gestörte Ruh!«
Hier seh' ich klar und helle
Die Welt, ihr Schattenglück; -
Zu seines Urstoffs Quelle
Sehnt sich der Geist zurück!
(Elise Sommer, 1767- ?)
Ich liebe meines Wesens Dunkelstunden,
in welchen meine Sinne sich vertiefen;
in ihnen hab ich, wie in alten Briefen,
mein täglich Leben schon gelebt gefunden
und wie Legende weit und überwunden.
Aus ihnen kommt mir Wissen, dass ich Raum
zu einem zweiten zeitlos breiten Leben habe.
Und manchmal bin ich wie der Baum,
der, reif und rauschend, über einem Grabe
den Traum erfüllt, den der vergangne Knabe
(um den sich seine warmen Wurzeln drängen)
verlor in Traurigkeiten und Gesängen.
(Rainer Maria Rilke, 1875-1926)
Neben ästhetisch-wohllautender Geborgenheit und Quellen der Erkenntnis injiziert die Melancholie nicht selten destruktivere Befindlichkeiten. Häufig ist sie in der Weltliteratur mit Todessehnsucht verbunden, wie es Sándor Petöfi, der als größter ungarischer Lyriker gilt, ausspricht. Nicht fehlen kann an dieser Stelle Hamlet, die paradigmatische Gestalt des Melancholikers, der in seinem berühmten Monolog (3. Akt, 1. Szene in ![]() Shakespeares Tagödie) den Freitod nur deswegen scheut, weil er etwas danach fürchtet.
Shakespeares Tagödie) den Freitod nur deswegen scheut, weil er etwas danach fürchtet.
Gebt einen Sarg mir und ein Grab
In tiefer, stiller Erde, - gebt!
Wo kein Empfinden, kein Gefühl,
Kein Herz und kein Gedanke lebt!
O du mein Kopf, du meine Brust,
Zwiefacher Fluch, der auf mir ruht!
Wozu mit Flammengeißeln selbst
Sich quälen in ohnmächt'ger Wut?
Warum sehnt dieses stolze Hirn
Gar zu den Sternen sich empor,
Wenn sein Geschick ihm rau befiehlt:
Kriech' auf der Erde hin, du Tor!?
Und wenn von aller Freud' und Lust,
Von allem, was des Daseins Zier,
Nicht das Geringste mir gewährt,
Wozu ward dieses Leben mir?
Und schlägt ein Herz in meiner Brust,
Das hell im Glück zu jubeln weiß,
Was gönnst Du, Gott der Seligkeit,
Ihm nichts als einen Blick aus Eis? ...
Gebt einen Sarg mir und ein Grab
In tiefer, stiller Erde, - gebt!
Wo kein Empfinden, kein Gefühl,
Kein Herz und kein Gedanke lebt! ...
(Sándor Petöfi, 1823-1849;
aus dem Ungarischen von Ignaz Schnitzer)
Sein oder Nichtsein, das ist hier die Frage:
Ob's edler im Gemüt, die Pfeil' und Schleudern
Des wütenden Geschicks erdulden, oder,
Sich waffnend gegen eine See von Plagen,
Durch Widerstand sie enden. Sterben – schlafen –
Nichts weiter! – und zu wissen, daß ein Schlaf
Das Herzweh und die tausend Stöße endet,
Die unsers Fleisches Erbteil – 's ist ein Ziel,
Aufs innigste zu wünschen. Sterben – schlafen –
Schlafen! Vielleicht auch träumen! – Ja, da liegt's:
Was in dem Schlaf für Träume kommen mögen,
Wenn wir den Drang des Ird'schen abgeschüttelt,
Das zwingt uns still zu stehn. Das ist die Rücksicht,
Die Elend lässt zu hohen Jahren kommen.
Denn wer ertrüg' der Zeiten Spott und Geißel,
Des Mächt'gen Druck, des Stolzen Misshandlungen,
Verschmähter Liebe Pein, des Rechtes Aufschub,
Den Übermut der Ämter, und die Schmach,
Die Unwert schweigendem Verdienst erweist,
Wenn er sich selbst in Ruh'stand setzen könnte
Mit einer Nadel bloß! Wer trüge Lasten,
Und stöhnt' und schwitzte unter Lebensmüh'?
Nur dass die Furcht vor etwas nach dem Tod –
Das unentdeckte Land, von des Bezirk
Kein Wandrer wiederkehrt – den Willen irrt,
Dass wir die Übel, die wir haben, lieber
Ertragen, als zu unbekannten fliehn.
So macht Gewissen Feige aus uns allen;
Der angebornen Farbe der Entschließung
Wird des Gedankens Blässe angekränkelt;
Und Unternehmungen voll Mark und Nachdruck,
Durch diese Rücksicht aus der Bahn gelenkt,
Verlieren so der Handlung Namen.
(William Shakespeare, 1564-1616;
aus dem Englischen von August Wilhelm Schlegel)
Nicht stets so morbid äußert sich die Schwermut vor allem in praktisch-realer Hinsicht, sonst wären von den vielen melancholischen Genies viel weniger Werke und Taten auf uns gekommen. Nach Ruhe und Schlaf als kleineren Todesgeschwistern sehnt sie sich, mit ihr einher gehen Einsamkeit, Desillusionierung, Gefühl und Erkenntnis für die Nichtigkeit des Daseins. Internationale Varianten dessen zeigen die Exempel des Russen Michail Lermontow, des Italieners Giacomo Leopardi und abermals ![]() Rilke.
Rilke.
Einsam tret ich auf den Weg, den leeren,
Der durch Nebel leise schimmernd bricht;
Seh die Leere still mit Gott verkehren
Und wie jeder Stern mit Sternen spricht.
Feierliches Wunder: hingeruhte
Erde in der Himmel Herrlichkeit...
Ach, warum ist mir so schwer zumute?
Was erwart ich denn? Was tut mir leid?
Nichts hab ich vom Leben zu verlangen
Und Vergangenes bereu ich nicht:
Freiheit soll und Friede mich umfangen
Im Vergessen, das der Schlaf verspricht.
Aber nicht der kalte Schlaf im Grabe.
Schlafen möcht ich so jahrhundertlang,
Dass ich alle Kräfte in mir habe
Und in ruhiger Brust des Atems Gang.
Dass mir Tag und Nacht die süße, kühne
Stimme sänge, die aus Liebe steigt,
Und ich wüsste, wie die immergrüne
Eiche flüstert, düster hergeneigt.
(Michail Lermontow, 1814-1841;
aus dem Russischen von Rainer Maria Rilke)
Nun wirst du ruhn für immer,
Mein müdes Herz. Es schwand der letzte Wahn,
Der ewig schien. Er schwand. Ich fühl’ es tief:
Die Hoffnung nicht allein
Auf holde Täuschung, auch der Wunsch entschlief.
So ruh für immer. Lange
Genug hast du geklopft. Nichts hier verdient
Dein reges Schlagen, keines Seufzers ist
Die Erde wert. Nur Schmerz und Langweil bietet
Das Leben, Andres nicht. Die Welt ist Kot.
Ergib dich denn! Verzweifle
Zum letzten Mal! Uns Menschen hat das Schicksal
Nur Eins geschenkt: den Tod. Verachte denn
Dich, die Natur, die schnöde
Macht, die verborgen herrscht zu unsrer Qual,
Und dieses Alls unendlich nicht’ge Öde!
(Giacomo Leopardi, 1798-1837;
aus dem Italienischen von Paul Heyse)
Andere fassen den Wein, andere fassen die Öle
in dem gehöhlten Gewölb, das ihre Wandung umschrieb.
Ich, als ein kleineres Maß und als schlankestes, höhle
mich einem andern Bedarf, stürzenden Tränen zulieb.
Wein wird reicher, und Öl klärt sich noch weiter im Kruge.
Was mit den Tränen geschieht? - Sie machten mich schwer,
machten mich blinder und machten mich schillern am Buge,
machten mich brüchig zuletzt und machten mich leer.
(Rainer Maria Rilke, 1875-1926)
Selbstverständlich fordern melancholische Gestalten auch zur Ironisierung und dem sprichwörtlichen Tritt in den Hintern heraus. Und bevor wir mit ihnen im todesschwangeren Tränenkrüglein ersaufen, versuchen wir uns zum Abschluss mit Klabunds Spott und Otto Julius Bierbaums rosskurigem Freundesbrief zu reanimieren.
Schau, den Finger in der Nase,
Oder an der Stirn,
Zeitigt manche fette Phrase
Das geölte Hirn.
Warum liebt der die Erotik?
Jener die Zigarrn?
Der die Aeropilotik?
Der den Kaiserschmarrn?
Warum geht's uns meistens dreckig?
Weshalb schreib ich dies Gedicht?
Warum ist das Zebra fleckig
Und Mariechen nicht?
Dennoch ahnt man irgendwie
Gottes Qualverwandschaft,
Trifft man unerwartet sie
Draußen in der Landschaft.
(Klabund, 1890-1928)
Freundesbrief an einen Melancholischen
Du klagst, mein Freund, und jammerst sehr,
Wie elend dieses Leben wär;
Es sei nicht auszuhalten. -
Was klagst du denn? Es ist dein Recht,
Bist du ein müd und fauler Knecht,
Dich gänzlich auszuschalten.
Kauf dir, o Freund, ein Pistolet
Und schieß dich tot, - hurra, juchhe!
Dann bist du gleich gestorben.
Doch macht des Pulvers Knallgetös
Dich, weil nervös du bist, nervös,
Brauchst du nicht zu verzagen.
Ich weiß ein Mittel ohne Knall,
Geräuschlos, prompt; für jeden Fall
Will ich dirs hiermit sagen:
O speise, Freundchen, Strychenin!
Das wird dich in den Himmel ziehn.
Dort geigst du mit den Engeln.
Falls aber, weil du heikel bist,
Strychnin dir unsympathisch ist
(Es schmeckt ein bisschen fade),
So brauchst du nicht gleich bös zu sein;
Mir fällt schon etwas andres ein:
Geh auf die Promenade
Und hänge dich an einen Ast.
Sobald du ausgezappelt hast,
Hängst du für ewig stille.
Wie? Kitzlig bist du an dem Hals?
Wohl, mein Geliebter! Diesesfalls
Gilts anderes Gebaren:
Spring in den Fluss, stürz dich vom Turm,
Lass dich gleich einem Regenwurm
Elektrisch überfahren.
Auch ist ein ziemlich sichrer Tod
Der durch komplette Atemnot
Infolge Ofengasen.
Du schüttelst immer noch den Kopf?
Ei, du verruchter Sauertopf,
Geh hin, dich zu purgieren!
Mach dir Bewegung, fauler Bauch,
So wird die liebe Seele auch
Vergnügt im Sein spazieren.
Ein wackres Wort heißt: resolut!
Hast du zum Sterben nicht den Mut,
So lebe mit Courage!
(Otto Julius Bierbaum, 1865-1910)
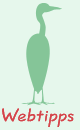 Melancholische Gedichte im Internet
Melancholische Gedichte im Internet
Eine weitere Sammlung zu Melancholie & Nostalgie enthält Oppis World; die Auswahl hier entstammt Melancholie im Gedicht in Gedichte für alle Fälle. Ansonsten bietet das Web wenig zu diesem Thema.
Verwandte Themen: Abschiedsgedichte · Herbstgedichte · Rainer Maria Rilke · William Shakespeare · Georg Trakl · Trauergedichte
Alle Themen: Startseite



